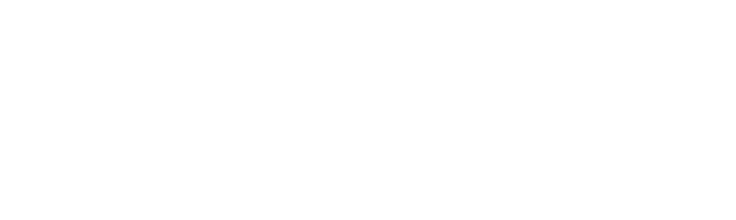Einleitung
Die digitale Transformation verändert nahezu alle Lebens- und Arbeitsbereiche und schafft neue Abhängigkeiten von Informationssystemen und Daten. Informationen gelten heute als eine der wertvollsten Ressourcen von Organisationen, zugleich sind sie einer Vielzahl an Gefahren ausgesetzt. Cyberangriffe, Industriespionage, Datenmissbrauch oder technische Ausfälle stellen Risiken dar, die sowohl die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit als auch das Vertrauen von Kunden, Partnern und Gesellschaft beeinträchtigen können.
Im wissenschaftlichen und praktischen Diskurs werden die Begriffe Informationssicherheit und Cybersecurity häufig gleichgesetzt. Diese Gleichsetzung ist jedoch ein weit verbreiteter Irrtum, da beide Konzepte unterschiedliche Schutzziele, Methoden und Betrachtungsebenen umfassen. Während die Informationssicherheit den umfassenden Schutz sämtlicher Informationen in allen Formen betrachtet, richtet sich die Cybersecurity primär auf die Abwehr digitaler Bedrohungen, die gezielt auf IT-Infrastrukturen und Netzwerke einwirken.
Der vorliegende Beitrag verfolgt das Ziel, die beiden Konzepte systematisch darzustellen, ihre Unterschiede deutlich herauszuarbeiten und ihr Zusammenspiel im Kontext moderner Bedrohungslagen kritisch zu beleuchten. Auf diese Weise soll ein vertieftes Verständnis entstehen, warum die präzise Abgrenzung zwischen Informationssicherheit und Cybersecurity notwendig ist, um wirksame und ganzheitliche Sicherheitsstrategien zu entwickeln.

1. Vom technischen Selbstverständnis der Cybersecurity zur strategischen Informationssicherheit
1.1. Historischer Ausgangspunkt: Cybersecurity als reine IT-Aufgabe
In den frühen Jahren digitaler Vernetzung wurde Sicherheit nahezu ausschließlich unter dem Begriff Cybersecurity verstanden. Die Verantwortung lag weitgehend bei den IT-Abteilungen, die eigenständig über technische Schutzmaßnahmen entschieden. Maßnahmen orientierten sich oft an aktuellen Bedrohungen oder technologischen Trends, weniger jedoch an den tatsächlichen geschäftlichen Anforderungen.
Das führte zu einem reaktiven Sicherheitsverständnis, das primär von Technik getrieben war. Beispielsweise wurden neue Firewalls, Antivirensoftware oder Verschlüsselungssysteme eingeführt, ohne zuvor zu prüfen, welche Informationen oder Geschäftsprozesse tatsächlich den höchsten Schutzbedarf hatten.
1.2. Der Bedarf nach einer strategischen Ebene
Mit zunehmender Digitalisierung wurde deutlich, dass diese technikzentrierte Sichtweise nicht ausreicht. Unternehmen erkannten, dass Sicherheit nicht nur eine Frage einzelner Maßnahmen ist, sondern eng mit den geschäftlichen Zielen, Prozessen und Werten verbunden sein muss.
Es entstand der Bedarf nach einer Ebene, die zwischen Business und IT vermittelt und die Sicherheit systematisch steuert. Diese Ebene sollte nicht selbst technische Maßnahmen umsetzen, sondern vorgeben, was geschützt werden muss, warum es wichtig ist und welche Anforderungen daraus abzuleiten sind.
1.3. Die Entstehung der Informationssicherheit
Aus diesem Bedarf entwickelte sich die Informationssicherheit. Sie definiert heute den Rahmen für alle sicherheitsrelevanten Maßnahmen in Organisationen und unterscheidet sich damit klar von der operativen Cybersecurity.
Die Informationssicherheit stellt sicher, dass Schutzmaßnahmen nicht willkürlich oder aus rein technischer Motivation umgesetzt werden, sondern dass sie:
- durch Risikoanalysen priorisiert werden,
- auf Asset-Betrachtungen basieren,
- und in Richtlinien und Mindestanforderungen übersetzt werden, die von den Fachabteilungen in Abstimmung mit der IS umgesetzt werden.
1.4. Der Wandel in der Praxis
In der Praxis führte dieser Wandel dazu, dass Sicherheitsmaßnahmen nicht länger allein von IT-Abteilungen entschieden werden. Stattdessen erfolgt eine Abstimmung zwischen Geschäftsführung, Fachabteilungen und IT unter der Leitung der Informationssicherheit.
Ein Beispiel: Früher konnte die IT-Abteilung festlegen, ein komplexes Verschlüsselungssystem einzuführen, ohne Rücksicht auf dessen Auswirkungen auf Geschäftsprozesse. Heute definiert die Informationssicherheit, welche Informationen in welchen Prozessen vertraulich zu behandeln sind und gibt Mindestanforderungen vor. Die IT setzt anschließend die passenden technischen Maßnahmen um, die diese Anforderungen erfüllen, ohne die Geschäftstätigkeit unnötig zu beeinträchtigen.
1.5. Erkenntnisse
Die Entstehung der Informationssicherheit markiert den Schritt von einer reaktiven, technikgetriebenen Sicherheitskultur hin zu einem strategischen, prozessorientierten Managementansatz. Während Cybersecurity nach wie vor eine zentrale Rolle in der operativen Abwehr digitaler Bedrohungen spielt, bildet die Informationssicherheit den übergeordneten Rahmen, der sicherstellt, dass Maßnahmen zielgerichtet, risikoorientiert und auf die geschäftlichen Bedürfnisse abgestimmt sind.

2. Informationssicherheit als Fundament ganzheitlicher Schutzkonzepte
2.1. Begriff und Zielsetzung
Informationssicherheit bezeichnet den Schutz sämtlicher Informationen einer Organisation, unabhängig davon, ob sie in digitaler Form, auf Papier, in Gesprächen oder im Wissen von Mitarbeitenden existieren. Ziel ist es, diese Informationen vor Verlust, Manipulation, unbefugtem Zugriff oder unbeabsichtigter Offenlegung zu schützen und damit die Handlungsfähigkeit, Verlässlichkeit und Reputation einer Organisation zu sichern.
Die klassischen Schutzziele lauten:
- Vertraulichkeit, beispielsweise durch die sichere Verwahrung von Vertragsunterlagen in einem abschließbaren Archiv.
- Integrität, etwa indem Prüfprotokolle gegen nachträgliche Änderungen geschützt werden.
- Verfügbarkeit, zum Beispiel durch die Aufbewahrung redundanter Aktenkopien oder die Einrichtung von Notfallplänen.
Darüber hinaus gewinnen erweiterte Ziele wie Authentizität, Verbindlichkeit und Resilienz zunehmend an Bedeutung, um komplexen Bedrohungslagen entgegenzuwirken.
2.2. Teilbereiche der Informationssicherheit
Informationssicherheit setzt sich aus mehreren Kernbereichen zusammen, die gemeinsam ein umfassendes Schutzsystem bilden. Diese Bereiche gehen weit über die reine IT hinaus und machen deutlich, dass Cybersecurity nur einen Teilaspekt darstellt.
- Human Resources Security
Der Mensch ist ein zentraler Faktor der Informationssicherheit. Maßnahmen reichen von Zuverlässigkeitsprüfungen bei Neueinstellungen über Vertraulichkeitsvereinbarungen bis hin zu Schulungen und Sensibilisierungen, um Mitarbeitende für den Umgang mit vertraulichen Informationen und für Gefahren wie Social Engineering zu rüsten. - Supplier Management
Externe Dienstleister und Zulieferer stellen potenzielle Risiken für die Informationssicherheit dar. Daher gehören sorgfältige Auswahlverfahren, vertragliche Sicherheitsvereinbarungen, regelmäßige Audits und klar definierte Schnittstellen zu diesem Teilbereich. - Physical Security
Physische Maßnahmen schützen Informationen vor Diebstahl, Zerstörung oder unberechtigtem Zugriff. Beispiele sind Zutrittskontrollen zu Archiven, die Aufbewahrung sensibler Dokumente in feuerfesten Tresoren oder der Schutz von Produktionsstätten und Prototypen durch Sicherheitszonen. - Data Protection
Der Schutz personenbezogener Daten ist ein zentrales Element der Informationssicherheit. Rechtsgrundlagen wie die DSGVO definieren verbindliche Anforderungen an die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung sensibler Daten. Informationssicherheit und Datenschutz sind dabei eng miteinander verzahnt, jedoch nicht identisch. - Cybersecurity
Cybersecurity konzentriert sich auf den Schutz digitaler Systeme, Netzwerke und Anwendungen vor Angriffen, Manipulation oder Ausfällen. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil, aber nur ein Teilbereich der Informationssicherheit. Während Cybersecurity technische Abwehrmaßnahmen bereitstellt, schafft Informationssicherheit den übergeordneten Rahmen und bindet auch nicht-digitale Informationswerte ein. - Compliance & Governance
Informationssicherheit muss in Einklang mit gesetzlichen, regulatorischen und normativen Anforderungen stehen. Dazu zählen internationale Standards wie ISO/IEC 27001, branchenspezifische Vorgaben wie TISAX, nationale Regelwerke wie das BSI-Gesetz oder die europäische NIS2-Richtlinie. Compliance dient dabei nicht nur der Rechtssicherheit, sondern auch der Vertrauensbildung bei Kunden, Partnern und Stakeholdern.
Diese Teilbereiche machen deutlich, dass Informationssicherheit ein interdisziplinäres Gesamtkonzept ist, das technische, organisatorische, rechtliche, physische und personelle Aspekte gleichermaßen berücksichtigt.
2.3. Prozesscharakter – PDCA-Zyklus
Informationssicherheit ist kein statisches Ziel, sondern ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Ein zentraler methodischer Ansatz ist der PDCA-Zyklus (Plan – Do – Check – Act), wie er in der ISO/IEC 27001 verankert ist:
- Plan (Planen): Analyse schützenswerter Informationen, Bewertung von Risiken, Definition von Sicherheitszielen, Erstellung von Richtlinien und Konzepten.
- Do (Umsetzen): Umsetzung organisatorischer, physischer und technischer Maßnahmen, Einführung von Schulungen, Etablierung von Notfallplänen.
- Check (Überprüfen): Regelmäßige Kontrolle der Wirksamkeit, interne Audits, Monitoring und Abgleich mit den vorgegebenen Zielen.
- Act (Verbessern): Ableitung von Optimierungsmaßnahmen, Anpassung an neue Bedrohungen, Integration von Lessons Learned nach Vorfällen.
Der PDCA-Zyklus gewährleistet, dass Informationssicherheit ein dynamisches System bleibt, das sich fortlaufend an technologische Entwicklungen, neue Bedrohungslagen und organisatorische Veränderungen anpasst.
2.4. Assets in der Informationssicherheit – Primäre und sekundäre Betrachtungsebenen
Ein wesentliches Element der Informationssicherheit ist die systematische Betrachtung von Assets, also jener Werte, die geschützt werden sollen. Anders als in der Cybersecurity, die häufig auf der Ebene einzelner Systeme oder Komponenten arbeitet, betrachtet die Informationssicherheit Assets in zwei Abstraktionsebenen: Primary Assets und Secondary Assets.
Primary Assets – die Geschäftsprozesse
Primary Assets sind die Geschäftsprozesse einer Organisation, in denen Informationen erzeugt, verarbeitet oder genutzt werden. Diese Prozesse stellen den eigentlichen Wert dar, da sie die Grundlage für die Geschäftstätigkeit bilden und unmittelbar an die Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit gebunden sind.
Beispiele für Geschäftsprozesse:
- „Vertragsmanagement“ in einem Versicherungsunternehmen gilt als Primary Asset. Er verarbeitet vertrauliche Kundendaten, weshalb die Vertraulichkeit von zentraler Bedeutung ist.
- „Produktentwicklung“ in der Industrie ist ein Primary Asset, bei dem die Integrität der Konstruktionsdaten entscheidend ist.
- „Patientenversorgung“ in einem Krankenhaus ist ein Primary Asset, bei dem die Verfügbarkeit der Patientenakten ausschlaggebend ist.
Secondary Assets – Träger und Ressourcen
Secondary Assets sind die Ressourcen, Medien und Umgebungen, die von den Geschäftsprozessen genutzt werden, um Informationen zu speichern, zu verarbeiten oder zu transportieren. Dabei handelt es sich nicht um jedes einzelne Gerät oder jede Person, sondern um generische Kategorien, die nach den CIA-Kriterien bewertet werden.
- Mitarbeitende: Als Wissensträger und Akteure sind sie selbst ein Secondary Asset. Schulungen, Sensibilisierung und Zuverlässigkeitsprüfungen sichern ihre Rolle in den Prozessen ab.
- Geschäftsräume und Gebäude: Büros, Archive, Produktionshallen oder Krankenstationen stellen Secondary Assets dar, da sie die physische Umgebung für Informationsverarbeitung schaffen. Zutrittskontrollen, physische Barrieren oder Brandschutz sind hier zentrale Maßnahmen.
- Technische Hilfsmittel: Kategorien wie Drucker, Serverräume oder Telefone sind Secondary Assets, deren Schutzbedarf sich nach den darin verarbeiteten Informationen richtet.
- Medien: Papierdokumente oder digitale Datenträger sind Secondary Assets, die Informationen speichern oder transportieren.
- Software: Anwendungen, die Prozesse unterstützen oder Informationen verarbeiten, zählen ebenso zu den Secondary Assets.
Secondary Assets beantworten die Frage: Welche Ressourcen und Infrastrukturen ermöglichen die Durchführung der Geschäftsprozesse und welche Anforderungen ergeben sich dabei aus den CIA-Kriterien?
2.5. Zusammenfassung
Informationssicherheit stellt ein übergeordnetes Konzept dar, das weit über den Schutz digitaler Systeme hinausgeht. Sie bezieht sich auf sämtliche Informationen einer Organisation, unabhängig von Form und Medium, und betrachtet diese stets im Kontext der zugehörigen Geschäftsprozesse. Die Differenzierung in Primary Assets (Geschäftsprozesse) und Secondary Assets (Ressourcen, Medien und Umgebungen) verdeutlicht, dass Informationssicherheit auf einer strategischen und abstrakten Ebene operiert. Dabei werden nicht einzelne Geräte oder Personen isoliert betrachtet, sondern Kategorien gebildet, die anhand der Schutzziele bewertet werden.
Die verschiedenen Teilbereiche wie Human Resources, Supplier Management, Physical Security, Data Protection, Compliance und Cybersecurity zeigen den interdisziplinären Charakter der Informationssicherheit. Sie verbindet organisatorische, rechtliche, physische, menschliche und technische Aspekte in einem ganzheitlichen Ansatz.
Mit Hilfe des PDCA-Zyklus wird außerdem deutlich, dass Informationssicherheit kein statischer Zustand ist. Vielmehr handelt es sich um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der sicherstellt, dass Maßnahmen regelmäßig überprüft und an neue Bedrohungen, technologische Entwicklungen und organisatorische Veränderungen angepasst werden.
Damit bildet die Informationssicherheit das strategische Fundament jeder modernen Sicherheitsarchitektur. Sie ist nicht auf technische Fragen reduziert, sondern adressiert Informationen als zentrale Ressource einer Organisation. Die folgenden Kapitel zeigen, wie sich innerhalb dieses Rahmens die Cybersecurity als Teilbereich positioniert und warum ihre Abgrenzung zur Informationssicherheit von entscheidender Bedeutung ist.

3. Cybersecurity als Verteidigung der digitalen Welt
3.1. Begriff und Zielsetzung
Cybersecurity bezeichnet den Schutz von Informationssystemen, Netzwerken, Anwendungen und Daten vor digitalen Angriffen, Missbrauch oder Manipulation. Sie ist ein Teilbereich der Informationssicherheit, unterscheidet sich jedoch durch ihre klare Fokussierung auf die digitale Sphäre. Ziel der Cybersecurity ist es, digitale Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit sicherzustellen und dabei gezielt Bedrohungen wie Schadsoftware, Ransomware, Phishing oder Angriffe durch organisierte Gruppen abzuwehren.
Cybersecurity agiert stärker technisch und operativ als die Informationssicherheit. Während letztere auf Geschäftsprozessebene denkt, arbeitet Cybersecurity auf System- und Komponentenebene.
3.2. Teilbereiche der Cybersecurity
Cybersecurity umfasst verschiedene Domänen, die sich überwiegend mit technischen Maßnahmen und digitalen Bedrohungen beschäftigen.
- Netzwerksicherheit
Schutz von Kommunikationswegen vor Abhören, Manipulation oder unbefugtem Zugriff durch Firewalls, Intrusion Detection und Verschlüsselung. - Endgerätesicherheit
Absicherung von Laptops, Smartphones, Servern oder IoT-Geräten gegen Schadsoftware, Missbrauch oder unbefugten Zugriff. - Anwendungssicherheit
Schutz von Softwareanwendungen vor Angriffen wie SQL-Injection, Cross-Site-Scripting oder unsicheren Schnittstellen. - Datensicherheit
Schutz digital gespeicherter Daten durch Verschlüsselung, Backups, Zugriffskontrollen und Redundanzkonzepte. - Identitäts- und Zugriffssicherheit
Sicherstellung, dass nur berechtigte Personen auf Systeme zugreifen können, unter anderem durch starke Authentifizierung, Single-Sign-On oder Zero-Trust-Modelle. - Incident Detection and Response
Fähigkeit, Sicherheitsvorfälle in Echtzeit zu erkennen, zu analysieren und geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten, unter Einsatz von SIEM- oder SOC-Strukturen. - Kritische Infrastrukturen und OT-Security
Schutz industrieller Steuerungssysteme, Energie- und Wasserversorgung oder medizinischer Geräte, die zunehmend digital vernetzt sind.
3.3. Der Prozesscharakter der Cybersecurity
Cybersecurity ist wie die Informationssicherheit ein kontinuierlicher Prozess, der sich permanent an neue Bedrohungen anpassen muss. Anstelle des PDCA-Zyklus orientiert sich Cybersecurity jedoch häufig an spezifischen Frameworks und Standards, wie:
- NIST Cybersecurity Framework (CSF) mit den Phasen Identify, Protect, Detect, Respond, Recover
- MITRE ATT&CK als Wissensbasis über Angriffsvektoren und Taktiken
- ISO/IEC 27035 für Incident Management
Diese Frameworks verdeutlichen, dass Cybersecurity hochgradig dynamisch ist und unmittelbar auf Bedrohungen reagieren muss. Während Informationssicherheit langfristige Strukturen vorgibt, liegt der Schwerpunkt der Cybersecurity auf operativer Verteidigung und schneller Reaktion.
3.4. Assets in der Cybersecurity
Im Gegensatz zur Informationssicherheit, die mit abstrakten Kategorien wie Primary und Secondary Assets arbeitet, befasst sich Cybersecurity mit konkreten technischen Assets. Dazu gehören alle Komponenten, die digital Informationen verarbeiten, speichern oder transportieren.
- Server und Rechenzentren: Schutz durch Firewalls, Intrusion Detection, Patch-Management und Redundanz.
- Endgeräte: Laptops, Smartphones, IoT-Geräte, die aktiv gegen Malware oder Diebstahl abgesichert werden müssen.
- Netzwerke und Kommunikationsinfrastruktur: Router, Switches, VPN-Systeme oder Cloud-Verbindungen, die gegen Manipulation oder Abhören gesichert werden.
- Anwendungen und Datenbanken: Systeme, die gezielt gegen Schwachstellen in Code oder Schnittstellen geschützt werden.
- Benutzerkonten und Identitäten: Verwaltung durch Identity Access Management und Multi-Faktor-Authentifizierung.
Cybersecurity beantwortet die Frage: Welche konkreten Systeme, Komponenten und digitalen Ressourcen müssen wie überwacht und abgesichert werden, um Angriffe zu verhindern oder ihre Auswirkungen zu minimieren?
3.5. Zusammenfassung
Cybersecurity ist ein spezialisierter Teilbereich der Informationssicherheit. Sie konzentriert sich ausschließlich auf die digitale Dimension und arbeitet auf der Ebene konkreter Systeme und Komponenten. Ihre Stärke liegt in der technischen Tiefe, in der operativen Reaktion auf Angriffe und in der Fähigkeit, digitale Infrastrukturen widerstandsfähig gegen hochdynamische Bedrohungen zu machen.
Damit unterscheidet sie sich grundlegend von der Informationssicherheit, die prozessorientiert und abstrakter arbeitet. Beide Konzepte sind jedoch untrennbar miteinander verbunden. Informationssicherheit liefert den strategischen Rahmen, Cybersecurity setzt diesen Rahmen in der digitalen Welt operativ um. Erst durch ihr Zusammenspiel entsteht ein umfassender Schutz für Organisationen.

4. Zusammenspiel von Informationssicherheit und Cybersecurity
4.1. Komplementäre Perspektiven
Informationssicherheit und Cybersecurity werden häufig als konkurrierende Begriffe verstanden. Tatsächlich handelt es sich jedoch um zwei Perspektiven, die sich ergänzen. Informationssicherheit betrachtet Informationen als strategische Ressource einer Organisation und leitet daraus Vorgaben, Prioritäten und Mindestanforderungen ab. Cybersecurity setzt diese Vorgaben in der digitalen Dimension technisch um und schützt die Systeme, in denen die Informationen verarbeitet werden.
4.2. Von der Strategie zur Umsetzung
Informationssicherheit legt fest, welche Informationen in welchen Prozessen welchen Schutzbedarf haben. Daraus entstehen Richtlinien, Standards und Maßnahmenkataloge, die für die Organisation verbindlich sind. Cybersecurity bildet die operative Umsetzungsebene. Sie sorgt durch Firewalls, Verschlüsselung, Monitoring oder Zugriffskontrollen dafür, dass die Anforderungen tatsächlich erfüllt werden.
Beispiel:
Informationssicherheit definiert, dass die Vertraulichkeit von Kundendaten im Geschäftsprozess „Vertragsmanagement“ höchste Priorität hat.
Cybersecurity implementiert daraufhin technische Maßnahmen wie Datenbankverschlüsselung, Zugriffsbeschränkungen und Protokollierung.
4.3. Unterschiedliche Rollen im Management
Die Informationssicherheit ist in der Regel im Management verankert. Sie spricht die Sprache von Geschäftsführung, Compliance und Fachabteilungen. Cybersecurity hingegen ist stärker in den operativen IT- und Security-Teams verortet und benötigt tiefes technisches Fachwissen, um aktuelle Bedrohungen abzuwehren.
Damit gilt:
- Informationssicherheit liefert den strategischen Rahmen.
- Cybersecurity sorgt für die operative Umsetzung.
4.4. Das Risiko ganzheitlich steuern
Nur wenn beide Ebenen ineinandergreifen, kann eine Organisation ihre Risiken wirksam steuern. Informationssicherheit verhindert, dass technische Maßnahmen isoliert und ohne Bezug zu geschäftlichen Zielen eingeführt werden. Cybersecurity stellt sicher, dass abstrakte Vorgaben nicht theoretisch bleiben, sondern praktisch wirksam umgesetzt werden.
Dieses Zusammenspiel ist besonders wichtig angesichts der dynamischen Bedrohungslage, da neue Angriffsmethoden laufend entstehen, während regulatorische Anforderungen gleichzeitig strenger werden. Ein wirksames Sicherheitskonzept muss deshalb strategisch abgestimmt und operativ flexibel sein.
4.5. Erkenntnisse
Informationssicherheit und Cybersecurity sind keine Gegensätze, sondern zwei Seiten derselben Medaille. Informationssicherheit definiert, was und warum etwas geschützt werden muss. Cybersecurity sorgt dafür, dass dies im digitalen Raum tatsächlich geschieht. Erst in Kombination entsteht ein Sicherheitsansatz, der sowohl den geschäftlichen Wert von Informationen als auch die reale Bedrohungslage angemessen berücksichtigt.

5. Schlussbetrachtung
Die Entwicklung von einer rein technischen Cybersecurity hin zu einer strategischen Informationssicherheit zeigt deutlich, dass Sicherheit in Organisationen heute weit mehr ist als die Abwehr digitaler Angriffe. Informationssicherheit hat sich als übergeordnete Disziplin etabliert, die Geschäftsprozesse und deren Schutzbedarf in den Mittelpunkt stellt. Sie verbindet organisatorische, rechtliche, physische, menschliche und technische Aspekte zu einem ganzheitlichen Konzept, das durch den PDCA-Zyklus kontinuierlich weiterentwickelt wird.
Cybersecurity bleibt in diesem Rahmen unverzichtbar, da sie die operative Verteidigung der digitalen Infrastrukturen übernimmt. Sie ist der Teilbereich der Informationssicherheit, der Bedrohungen in Echtzeit begegnet, Systeme absichert und konkrete technische Maßnahmen umsetzt.
Das Zusammenspiel beider Ebenen ist entscheidend, da Informationssicherheit definiert, welche Werte zu schützen sind und mit welchem Prioritätsgrad. Cybersecurity sorgt dafür, dass diese Vorgaben in der digitalen Sphäre wirksam umgesetzt werden. Erst durch diese Verbindung entsteht ein Sicherheitskonzept, das sowohl die geschäftliche Bedeutung von Informationen berücksichtigt als auch den dynamischen Bedrohungen des digitalen Zeitalters standhält.
Damit wird deutlich, dass Informationssicherheit und Cybersecurity keine synonymen Begriffe sind, sondern komplementäre Konzepte. Ihre klare Differenzierung und ihr abgestimmtes Zusammenspiel bilden die Grundlage für moderne Sicherheitsstrategien, die sowohl den Anforderungen der Unternehmensführung als auch den Herausforderungen der IT gerecht werden.